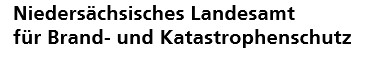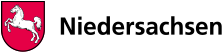Mitwirkende im Katastrophenschutz
Der Katastrophenschutz obliegt zunächst als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den Städten Cuxhaven und Hildesheim. Diese Behörden werden als untere Katastrophenschutzbehörden bezeichnet. Die obere Katastrophenschutzbehörde ist das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) und die oberste Katastrophenschutzbehörde das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung (MI).
Den größten Teil der Einsatzkräfte und Einsatzmittel im Katastrophenschutz stellen die Feuerwehren. Insgesamt engagieren sich in Niedersachsen 3.410 freiwillige Feuerwehren und neun Berufsfeuerwehren mit rund 140.000 Mitgliedern. Weitere Katastrophenschutzkräfte stellen unter anderem die Hilfsorganisationen (das Deutsches Rotes Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter Unfallhilfe, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Küstenregionen). Durch die Hilfsorganisationen können unter anderem die Grundeinheiten des Sanitätsdienstes, des Betreuungsdienstes und des Wasserrettungsdienstes aufgestellt werden. In diesen Einheiten und Einrichtungen wirken Helferinnen und Helfern freiwillig mit. Die genannten Einheiten sind im direkten Zugriff der Katastrophenschutzbehörden angesiedelt. Sie erhalten aus Bund- und Länderfinanzierungen Mittel und Fahrzeuge, die zur Bewältigung von Katastrophenschutz- und Zivilschutzaufgaben benötigt werden.
Einheiten und Einrichtungen des Bundes
Auf die Einheiten und Einrichtungen des Bundes, wie das Technische Hilfswerk (THW), die Bundeswehr und die Bundespolizei, besteht durch die Katastrophenschutzbehörden kein direkter Zugriff. Das THW als zentrale Einrichtung des Bundes kann allerdings im Katastrophenfall zur inländischen Hilfe herangezogen werden. Hauptsächlich werden durch das THW die Bereiche schwere Bergung, technische Logistik und Kommunikation durch Material und Personal abgedeckt. Ein Einsatz des THW erfolgt in der Regel durch Unterstellung oder im Rahmen der Amtshilfe. Rund 6.500 Helferinnen und Helfer mit diversen Fachgruppen und Fachzügen stehen im Land Niedersachsen für Amtshilfeeinsätze zur Verfügung.
Ebenso wichtig im Katastrophenfall ist die Sicherung des öffentlichen Rechts. Die Polizei führt alle Maßnahmen im Bereich Sicherung, Verkehrslenkung und Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen durch. In den letzten Jahren gab es immer wieder personalintensive Einsätze, wie Sturmfluten oder Überschwemmungen. Bei diesen kann durch eine Regelung im Grundgesetz auch die Bundeswehr zum Einsatz angefordert werden.
Einbindung und Verpflichtung von privaten Trägern und Unternehmen
Weiterhin können Einheiten und Einrichtungen privater Träger im Katastrophenschutz mitwirken, wenn sie hierzu geeignet sind und ihr Träger die Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. Die Eignung wird hierbei durch die untere Katastrophenschutzbehörde festgestellt. Ein Anspruch auf die Feststellung der Eignung besteht jedoch nicht.
Nach dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) ist darüber hinaus jede Person dazu verpflichtet, bei der Katastrophenbekämpfung Hilfe zu leisten, wenn die vorhandenen Einsatzkräfte nicht ausreichen und sie von der unteren Katastrophenschutzbehörde dazu aufgefordert wird. Zum Tragen kommt dies z. B. für Unternehmende, Speditions- und Baufirmen, Kühl- und Wärmeaggregatbesitzer, Versorgungs-, Bus- oder Bahnunternehmen. Ohne die Mithilfe solcher Unternehmen wäre die Bewältigung in Katastrophenlagen kaum möglich. Eine derartige Hilfeleistung kann nur verweigert werden, wenn eine andere höherwertigen Pflicht überwiegt oder eine Gefährdung für den Dienstverpflichtenden vorliegt. Bei derartigen Unternehmen können auch Sachleistungen eingefordert werden. Diese Leistungspflichten sind mit einer entsprechenden Entschädigungspflicht verbunden.
Katastrophenschutz beginnt allerdings grundsätzlich bei jedem Einzelnen. In einigen Notlagen, wie z. B. bei Stromausfällen oder bei Naturereignissen, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis staatliche Hilfe bei allen angekommen ist. Wer selbst gut vorbereit ist, schützt nicht nur sich und seine Familie, sondern entlastet auch die Einsatzkräfte. Die Hilfsbedürftigen werden somit schneller erreicht.
Im Ratgeber Vorsorgen für Krisen und Katastrophen (BBK) finden Sie weitere Informationen, wie Sie sich richtig vorbereiten können.