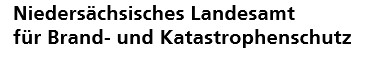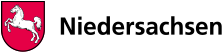Kommunaler Katastrophenschutz
Was ist eine Katastrophe?
Eine Katastrophe wird im Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) als Notstand definiert, der Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einem solchen Maß gefährdet oder beeinträchtigt, dass seine Bekämpfung durch die zuständigen Behörden und notwendigen Einsatz- und Hilfskräfte eine zentrale Leitung erfordert.
Zusammenfassend ist eine Katastrophe durch folgende Punkte definiert:
- Gefährdung/Beeinträchtigung bestimmter Rechtsgüter
- Erforderlichkeit der einheitlichen Führung einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzkräfte
- Dauer über einen längeren Zeitraum
- Notwendigkeit einheitlicher Koordination und Zusammenarbeit mehrerer Behörden und Stellen
- Erforderlichkeit einer zentralen Leitung durch die übergeordnete Verwaltungsstruktur
Was ist Katastrophenschutz und wer ist dafür zuständig?
Katastrophenschutz gemäß des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG) ist in erster Linie die Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen. Nicht zu verwechseln mit dem Zivilschutz, welcher auf den Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall mittels nicht-militärischer Maßnahmen ausgerichtet ist. Beide Bereiche bilden zusammen den Bevölkerungsschutz, der alle Einrichtungen und Maßnahmen umfasst, die der Gefahrenabwehr und dem Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen- oder Katastrophenfällen dienlich sind. Während der Zivilschutz in der Zuständigkeit des Bundes liegt, ist für den Katastrophenschutz das Land zuständig.
Der Katastrophenschutz in Niedersachsen wird zunächst durch die unteren Katastrophenschutzbehörden (Landkreise und kreisfreie Städte) für ihre Zuständigkeitsbezirke sichergestellt, indem Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes durch öffentliche und private Träger aufgestellt werden. Das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) übt als obere Katastrophenschutzbehörde die Fachaufsicht über die unteren Katastrophenschutzbehörden aus und untersteht selbst der Fachaufsicht der obersten Katastrophenschutzbehörde, dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung. Zudem können im Katastrophenschutz auch andere Behörden, Dienststellen und sonstige Träger öffentlicher Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeit oder durch die Amtshilfe mitwirken.
Schadensfälle aller Art obliegen im Regelfall zunächst der Leitung der allgemeinen Gefahrenabwehr (Stadt oder Gemeinde). Die unteren Katastrophenschutzbehörden sind bei diesen regulären Einsatzfällen, wie beispielsweise Bränden oder technische Hilfeleistungen, nicht zuständig. Stellt das Ereignis nun aber im Gesamtbild eine größere Lage nach Definition der Katastrophe dar und erfordert eine zentrale Leitung, kann der Hauptverwaltungsbeamte des Katastrophenschutzstabes, i. d. R. der Landrat, den Katastrophenfall feststellen. Ab diesem Zeitpunkt sind alle anderen Leitungsorgane dem Katastrophenschutzstab unterstellt. Sollte bei größeren Schadensereignissen weitere Hilfe benötigt werden und die notwendigen Ressourcen nicht (mehr) vorhanden sein, unterstützen sich zunächst benachbarte untere Katastrophenschutzbehörden im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Falls unter der Zuhilfenahme von Nachbarschaftshilfe weitere Ressourcen für die Katastrophenbekämpfung notwendig sein sollten, können über das Kompetenzzentrum Großschadenslagen (KomZ) im Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung weitere Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes aus ganz Niedersachsen angefordert werden. Dies wird durch die überörtliche Einsatzfähigkeit der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Niedersachsen sichergestellt, sodass z. B. Katastrophenschutzeinheiten aus dem Landkreis Aurich für Einsätze im Landkreis Göttingen entsendet werden können.
Bei größeren Schadenslagen, wie z. B. der Ahrtalkatastrophe im Jahr 2021, hört die solidarische Zusammenarbeit im Katastrophenschutz selbstverständlich nicht an den Grenzen Niedersachsens auf. Über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) oder durch bilaterale Absprachen der Bundesländer können Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes aus Niedersachsen in andere Bundesländer entsendet werden oder nach Niedersachsen alarmiert werden. Im Grenzgebiet zu anderen Bundesländern und den Niederlanden gibt es zusätzlich bilaterale Vereinbarungen zur gegenseitigen Unterstützung bei größeren Einsätzen. Die Trilaterale Brand- und Katastrophenschutzkonferenz zur Stärkung des grenzübergreifenden Brand- und Katastrophenschutzes zwischen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Königreich der Niederlande belebt den länderübergreifenden Austausch. Die Veranstaltung wird im zweijährigen Turnus durch die teilnehmenden Länder durchgeführt, um im Rahmen von Workshops, Vorträgen und Networking die grenzübergreifende Zusammenarbeit gewinnbringend für die Bevölkerung zu stärken und weiterzuentwickeln.
Als Teil der Europäischen Union beteiligt sich Deutschland darüber hinaus an dem Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union (EU Civil Protection Mechanism – UCPM), das allen Mitgliedsländern die Möglichkeit eröffnet, sich gegenseitig mit spezialisierten Katastrophenschutzeinheiten zu unterstützen. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterstützten zuletzt im Jahr 2025 mit den GFFF-V-Einheiten (Ground Forest Firefighting using Vehicles) als spezialisierte bodengebundene Waldbrandbekämpfungseinheit die Einsatzkräfte Spaniens bei einer Waldbrandkatastrophe. Hingegen waren beim Hochwasserereignis 2023/2024 in Niedersachsen französische Katastrophenschutzeinheiten mit spezialisierten Hochwasserschutzsystemen im Einsatz, um den örtlichen Einsatzkräften mit dieser Spezialressource zur Seite zu stehen.
Außergewöhnliches Ereignis und Katastrophenvoralarm
Durch die Novellierung des NKatSG im Jahr 2020 wurden weitere gesetzliche Regelungen geschaffen, um den Einsatz von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes und/oder des Katastrophenschutzstabes unterhalb der Schwelle eines Katastrophenfalls zu ermöglichen. Hierzu wurden das „Außergewöhnliche Ereignis“ und der „Katastrophenvoralarm“ im gesetzlichen Rahmen der Gefahrenabwehr verankert. Diese zusätzliche Gesetzesgrundlage konkretisiert u. a. die Rechts- und Freistellungsansprüche der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Eine rechtliche Verzahnung für den Einsatz von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes ist ebenfalls im Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz (NRettG) und im Niedersächsischen Brandschutzgesetz (NBrandSchG) zu finden.